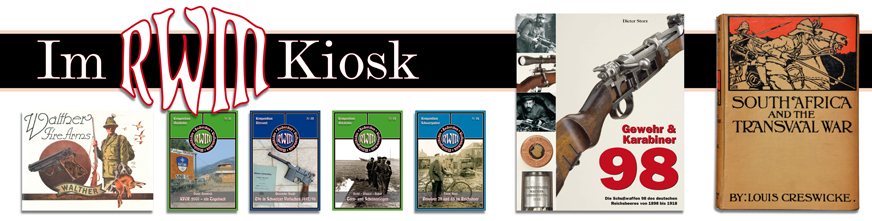RWM 09: Vorwärts zum Vergangenen – der Ulanensäbel M 1873
 Kaum war ein neuer Säbel eingeführt, beschwerten sich Preußens Ulanen über das Modell. Darauf bekamen sie das Modell 1873 – das keinen Fortschritt brachte.
Kaum war ein neuer Säbel eingeführt, beschwerten sich Preußens Ulanen über das Modell. Darauf bekamen sie das Modell 1873 – das keinen Fortschritt brachte.
Von Christian Wagner M.A.
Im preußischen Kriegsministerium dürfte so mancher Nerv blank gelegen haben, als bei den Ulanen um 1866 herum erste Forderungen nach einem neuen Säbel laut wurden; hatte man doch nach sage und schreibe 40 Jahren der Diskussion soeben erst den neuen Korbsäbel M 1852 eingeführt. Ursprünglich sollte dieser endlich die älteren Säbel mit Bügelgefäß nach englischer Art ablösen und durch seine Qualität weitere Diskussionen beenden. Was folgte, war jedoch ein neuer Akt im großen Schauspiel preußischer Bürokratie.
Der Auftakt war vielversprechend. In Rekordzeit wurde der Anspruch anerkannt und Abhilfe geschaffen. Irritationen traten laut Maier kurz vor der Einführung des Säbels auf. Eine Allerhöchste Kabinettsorder (A.K.O.) vom 6. März 1873 befahl den Ulanen das Ablegen der Säbel des Musters von 1852. Das Anlegen der neuen Säbel wurde jedoch erst mit der A.K.O. vom 22. Juni desselben Jahres befohlen. Sollten diese A.K.O.s wörtlich ausgeführt worden sein, so hätten die Ulanen drei Monate ohne Symbol von Status, Stand und Ehre zubringen müssen. Für die damalige Zeit war das ein unglaublicher Affront und möglicherweise die Danksagung des Kriegsministeriums für die Brüskierung durch eine als dreist empfundene Forderung. In Behördensprache übersetzt hieß diese doch nichts anderes, als daß die ministerialen Beamten ihre Arbeit nicht sachgemäß ausgeführt hatten. ...
Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 09 ab Seite 620.
|
Die RWM-Depesche 09 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |
 |
Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.
RWM 09: Krnka: Ein Böhme baut Rußlands Gewehre um
 Wir zeigen in dieser Ausgabe der RWM-Depesche nicht nur ein unbekanntes Exemplar des Cornish-Gewehrs aus dem russischen Truppenversuch. Sie lesen hier außerdem, wie es dazu kam, daß ein böhmischer Regimentsbüchsenmacher die Infanteriewaffen des russischen Zarenreichs umbauen konnte.
Wir zeigen in dieser Ausgabe der RWM-Depesche nicht nur ein unbekanntes Exemplar des Cornish-Gewehrs aus dem russischen Truppenversuch. Sie lesen hier außerdem, wie es dazu kam, daß ein böhmischer Regimentsbüchsenmacher die Infanteriewaffen des russischen Zarenreichs umbauen konnte.
von Branko Bogdanovic und Aleksey Klischin
Sylvestr Krnka (1825-1902) war österreichischer Büchsenmacher böhmischer Herkunft. Er stammte aus Großhaid (Velký Bor) wenige Kilometer westlich Strakonitz im Königreich Böhmen, das heute dank der CZ-Pistolen bekannt ist. Krnka ging 1838 nach Josefstadt/Wien, um bei dem angesehenen Meister Matthias Nowotný die Büchsenmacherei zu lernen. Am 15. März 1848 kam er in die westböhmische Kleinstadt Wolin (rund 10 km südlich Strakonitz) und wurde dort Büchsenmacher der österreichischen Nationalgarde. Diese war am 14. Februar 1848 in Wien von den Revolutionären aufgestellt und dann in allen größeren Orten eingerichtet worden. Nach den Unruhen wurde die Nationalgarde 1851 wieder aufgelöst.
Krnkas erstes Hinterladungssystem aus dem Jahr 1849 mit Perkussionsanzündung verwendete die Robert-Papierpatrone (vergleiche das französische Patent № 8061 aus dem Jahr 1861). Grundlage für Krnkas Waffe war wohl das österreichische Augustin-Gewehr M. 1842, ein Vorderlader. Der Umbau erfolgte, indem der Pulversack abgeschnitten und auf ein dann geschnittenes Gewinde ein großes bronzenes System aufgeschraubt wurde. Die Verriegelung erfolgte über einen Querriegel aus Stahl. Dieser Querblock mit linksseitiger Achse ähnelte stark den Systemen von Joslin, Snider, Soper und Cornish. Das Öffnen nach links war ungewöhnlich, da Cornish, Soper und die Snider-Varianten nach rechts öffneten.
Weiterlesen: RWM 09: Krnka: Ein Böhme baut Rußlands Gewehre um
RWM 09: Der Train – Ohne Bewegung keine Verpflegung
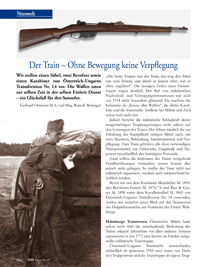 Wir stellen einen Säbel, zwei Revolver sowie einen Karabiner von Österreich-Ungarns Traindivision Nr. 14 vor. Die Waffen taten zur selben Zeit in der selben Einheit Dienst – ein Glücksfall für den Sammler.
Wir stellen einen Säbel, zwei Revolver sowie einen Karabiner von Österreich-Ungarns Traindivision Nr. 14 vor. Die Waffen taten zur selben Zeit in der selben Einheit Dienst – ein Glücksfall für den Sammler.
Gerhard Ortmeier M.A. und Mag. Reinolf Reisinger
„Die beste Truppe war der Train, der trug den Säbel nur zum Schein, und damit er keinen tötet, war er oben zugelötet“. Die launigen Zeilen eines Gassenhauers zeigen deutlich: Der Ruf von militärischen Nachschub- und Versorgungsformationen war auch vor 1914 nicht besonders glänzend. Da machten die Infanterie als „Krone aller Waffen“, die elitäre Kavallerie und die feuerstarke Artillerie bei Militär und Zivil schon weit mehr her.
Jedoch beruhte die militärische Schlagkraft dieser imageträchtigen Truppengattungen nicht zuletzt auf den Leistungen des Trains. Der führte nämlich die zur Erhaltung der Kampfkraft nötigen Mittel nach, wie etwa Munition, Bekleidung, Sanitätsmaterial und Verpflegung. Zum Train gehörten alle dazu notwendigen Transportmittel, wie Fuhrwerke, Zugpferde und Tragetiere einschließlich des benötigten Personals.
Weiterlesen: RWM 09: Der Train – Ohne Bewegung keine Verpflegung
RWM 09: Zur Bewaffnung der friederizianischen Infanterie
 Das Jahr der 300sten Wiederkehr des Geburtstages des großen preußischen Königs Friedrich II. eignet sich geradezu famos, um schlaglichtartig die Waffe und den Waffengebrauch der friderizianischen Infanterie zu beleuchten.
Das Jahr der 300sten Wiederkehr des Geburtstages des großen preußischen Königs Friedrich II. eignet sich geradezu famos, um schlaglichtartig die Waffe und den Waffengebrauch der friderizianischen Infanterie zu beleuchten.
Von Eugen A. Lisewski M.A.
Vom preußischen König Friedrich II., genannt „der Große“, ist folgendes Zitat überliefert: „Die Schlachten werden durch Feuerüberlegenheit gewonnen. Von den Angriffen gegen feste Stellungen abgesehen, wird die schneller ladende Infanterie allemal über die langsamer ladende siegen. Aus diesem Grunde habe ich nach dem Kriege so sehr darauf gedrungen, daß die Infanterie schnell ladet und der Soldat möglichst gewandt ist“.
Das Gewehr. Der bayerische Generalleutnant und Militärhistoriker Johann Ritter von Heilmann (1825-1888) beschreibt die Infanteriegewehre der friederizianischen Armee wie folgt:
Weiterlesen: RWM 09: Zur Bewaffnung der friederizianischen Infanterie
RWM 09: Die französischen P.38
 Frankreich nahm es 1945 nicht so genau mit dem alliierten Kriegsziel, die deutsche Rüstungsindustrie zu zerstören. Zu verlockend waren die Kapazitäten von Mauser in Oberndorf. Dort lief die Fertigung von Waffen – darunter der Pistole 38 – bis Mitte 1946 weiter. Die Sowjets setzten dann im alliierten Kontrollrat die Sprengung der Mauser-Werke durch. Die Pistolen 38 nutzte Frankreich beispielsweise im Indochina-Krieg.
Frankreich nahm es 1945 nicht so genau mit dem alliierten Kriegsziel, die deutsche Rüstungsindustrie zu zerstören. Zu verlockend waren die Kapazitäten von Mauser in Oberndorf. Dort lief die Fertigung von Waffen – darunter der Pistole 38 – bis Mitte 1946 weiter. Die Sowjets setzten dann im alliierten Kontrollrat die Sprengung der Mauser-Werke durch. Die Pistolen 38 nutzte Frankreich beispielsweise im Indochina-Krieg.
Von Mauro Baudino und Gerben van Vlimmeren
Mauser konnte zwar für sich beanspruchen, mit der C96 die erste erfolgreiche Selbstladepistole gebaut zu haben. Ein großer Teil des Ruhms der Firma ist aber auf Konstruktionen begründet, die ab 1930 entstanden. So kam beispielsweise die Fertigung der Parabellum-Pistole P. 08 von DWM Berlin zu Mauser nach Oberndorf. Deren Fertigung endete allerdings 1942 und wurde erst im Mai 1945 wieder aufgenommen, als die Franzosen Oberndorf und das Mauser-Werk besetzt hatten. In der Zwischenzeit hatte Mauser die Walther-Konstruktion P. 38 gebaut, die die P. 08 abgelöst hatte. Den Franzosen war sofort klar, welche großen Kapazitäten ihnen das besetzte Mauser-Werk bot. Es erlaubte ihnen, erneut mit der Fertigung von Pistolen P. 08, P. 38, des Modells HSC und von Karabinern und Maschinenwaffen zu beginnen.
CIP: Patronenmaße online abrufen
Die CIP hat alle aktuellen Datenblätter für genormte Patronen online gestellt. Sie sind auf der CIP-Netzseite einzusehen.
Die CIP-Datenblätter enthalten alle relevanten Daten zu Patronen für Lang- und Kurzwaffen, die von der Kommission normiert wurden. Diese Daten umfassen die genaue Vermaßung der Hülse, des Patronenlagers sowie des Laufprofils und den maximal zulässigen Gasdruck.
RWM 09: Präzise wie ein Uhrwerk – Karabiner 31
 Schweizer Präzision ist ein oft bemühtes Topos. Im Fall des Karabiners 31 trifft es aber zu. Die Waffen sind sehr ordentlich gearbeitet, schießen präzise und sind auf dem deutschen Markt erstaunlich günstig.
Schweizer Präzision ist ein oft bemühtes Topos. Im Fall des Karabiners 31 trifft es aber zu. Die Waffen sind sehr ordentlich gearbeitet, schießen präzise und sind auf dem deutschen Markt erstaunlich günstig.
Von Dr. Elmar Heinz
Wie wichtig die Wahrnehmung ist, zeigt das Beispiel der schweizerischen Infanteriegewehre und -karabiner. G 11, K 11 und K 31 sind hervorragend verarbeitete Waffen. Sie schießen bemerkenswert präzise, die Abzüge sind traumhaft. Dennoch stehen sie in Deutschland im Schatten des Karabiners 98. Der wird im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs wahrgenommen – der K 31 nicht. Das spiegelt sich im Preis wieder. Der Fachhandel bietet gute Karabiner 31 oft zu Preisen weit unter 250 Euro an. Damit ist dies eine ideale Waffe nicht nur für Einsteiger.
Schweiz war Vorreiter. Um 1880 war die Schweiz bei den Infanteriegewehren führend. Mit dem Geschoßkaliber von 7,5 mm war sie noch zu Schwarzpulverzeiten allen anderen Staaten voran. Ihre Gewehrpatrone diente als Vorbild für die deutsche. Auch bei der Suche nach dem besten Verschlußsystem war die Schweiz richtungsweisend. Der Geradezugverschluß ermöglicht ...
Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 09 ab Seite 640.
|
Die RWM-Depesche 09 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |
 |
Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.
RWM 08: Werndls M. 1877 für Wiederlader
 In dieser Studie behandeln wir das Wiederladen der Patrone für das Werndl-Gewehr. Sie war eine der ersten europäischen Patronen mit Metallhülse für ein Hinterladungsgewehr, geladen mit Schwarzpulver sowie einem papiergewickelten Geschoß.
In dieser Studie behandeln wir das Wiederladen der Patrone für das Werndl-Gewehr. Sie war eine der ersten europäischen Patronen mit Metallhülse für ein Hinterladungsgewehr, geladen mit Schwarzpulver sowie einem papiergewickelten Geschoß.
von Gianluca Bordin und John Ceruti
Wir untersuchen die grundlegenden Eigenschaften der Patrone und zeigen dann Lösungsansätze für die verschiedenen Probleme, die mit dem Wiederladen verbunden sind. Da sowohl ein Werndl-Gewehr Modell 1873/77 als auch ein Mannlicher-Gewehr Modell 1886 (s. RWM 03, S. 158ff.) zur Verfügung stehen, die beide für die „11 mm Scharfe Gewehr-Patrone M. 1877“ (11,15 mm×58 R) eingerichtet sind, können wir die Gelegenheit nutzen, um die ballistischen Eingeschaften von Patrone und Waffe zu untersuchen. Da nur sehr wenig Literatur zur Verfügung stand haben wir das historische Aktenmaterial ausgiebig ausgewertet. Das ist grundlegend, da die Patrone als obsolet angesehen wird und auch nicht in der Liste der CIP (Commission Internationale Permanente) aufgeführt wird.
...
Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 08 ab Seite 538.
|
Die RWM-Depesche 08 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |
 |
Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.
RWM 08: 1733 – Als Elbing dem Mann Frankreichs huldigte
 Waffen sind Gegenstände, die auch zur Repräsentation verwendet werden. Diese Prunkflinte aus den 1730er Jahren war ein solches repräsentatives Geschenk. Sie zeigt, wie verwickelt damals die Machtinteressen der europäischen Herrscher waren.
Waffen sind Gegenstände, die auch zur Repräsentation verwendet werden. Diese Prunkflinte aus den 1730er Jahren war ein solches repräsentatives Geschenk. Sie zeigt, wie verwickelt damals die Machtinteressen der europäischen Herrscher waren.
von Dr. Elmar Heinz
Auf den ersten Blick handelt es sich um eine verzierte Steinschloßflinte – mehr nicht. Diese fast schon überreichen Verzierungen umschließen aber zwei Inschriften, die uns Ort, Datum und politische Umstände ihrer Entstehung verraten.
Die sehr gut erhaltene und auf 1733 datierte Waffe ist mit 90 cm ausgesprochen kurz. Die Mündung ist entenschnabelförmig ausgeführt. Auf dem Schloßblech ist in einer Schleife der Name Lazaro Lazarino eingraviert. Der Støckl nennt zwei Büchsenmacher dieses Namens. Der 1783 erwähnte Vater soll denmach angeblich aus Brescia in Italien stammen, der Sohn wird mit „1800-1850“ angegeben. Beide sind in Braga (Portugal) verortet.
Der Nußbaumschaft weist eine Backe auf und ist mit geschnitztem Blumen- und Rocaillendekor versehen. Der vordere Schaftabschluß besteht aus Horn. Der Schaft ist vollflächig mit feinen Silberdrahteinlagen mit Rocaillenwerk und Blattwerksranken versehen. Schloßplatte, Eisenbeschläge und die hintere Laufhälfte weisen feuervergoldeten fl oralen Eisenschnitt auf. Die kannelierte hintere Laufhälfte mit Rückenschiene trägt eine Gravur in polnischer Sprache: „Janie Czapski Spodlona Oyczyznd Wielki Senatorze Teraz Polska Przyzna Miasto Elblaeg Ty Jeden Moglbys Leszczynskiego Ratowac` Y Stawec dawnae Dla Polski Zachowac`“.
Der konische, vordere Teil des Laufes trägt eine etwas holprig formulierte lateinische Inschrift, deren Einzelteile mit etwas Arbeit sinnvoll zusammenzufügen sind. Sie lautet: ...
Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 08 ab Seite 534.
|
Die RWM-Depesche 08 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |
 |
Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.
RWM 08: Ersehnt und verhaßt – Kavalleriesäbel M 1852
 In den Wehrzeitschriften des 19. Jahrhunderts wurde über militärische Anschaffungen hitzig diskutiert. Der eine wünschte sich den Korbsäbel zur Sicherheit seiner Waffenhand, der andere befürchtete die moralische Erosion der Kavallerie durch den bloßen Gedanken an persönliche Sicherheit. Die Realität holte die Debatte schließlich ein.
In den Wehrzeitschriften des 19. Jahrhunderts wurde über militärische Anschaffungen hitzig diskutiert. Der eine wünschte sich den Korbsäbel zur Sicherheit seiner Waffenhand, der andere befürchtete die moralische Erosion der Kavallerie durch den bloßen Gedanken an persönliche Sicherheit. Die Realität holte die Debatte schließlich ein.
Von Christian Wagner M.A.
Die Nachteile der alten Blüchersäbel wurden deutlich, als die preußische Reiterei nach drei Jahrzehnten des Friedens im Jahr 1848 ein Kavalleriegefecht gegen dänische Truppen führte. Bei allen preußischen Verwundeten dieses Aufeinandertreffens befanden sich die Verletzungen ausschließlich im Bereich der rechten Hand. Das war ein deutlicher Hinweis auf den mangelnden Schutz durch lediglich einen Bügel an Stelle eines Korbs. Zeitgenössische Berichte belegen weiterhin, daß das Abwehren eines Hiebs mit anschließender Sicherung nicht leicht, das Parieren eines auf die Hand gezielten Hiebs sehr schwierig und das Stoßen mit dem Säbel nach englischem Muster gar nicht möglich gewesen sei. Die Versuche, den alten Säbel mit einem zusätzlichen Handschutz nachzurüsten, blieben hinter den Erwartungen zurück. So wurde ...
Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 08 ab Seite 550.
|
Die RWM-Depesche 08 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |
 |
Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.