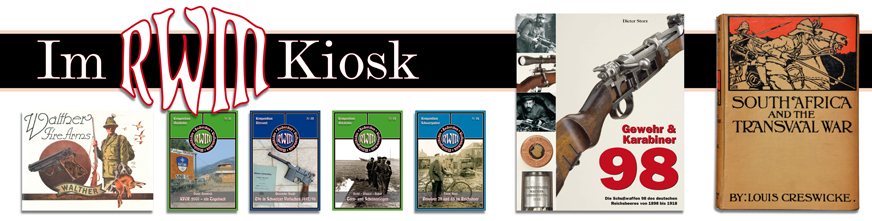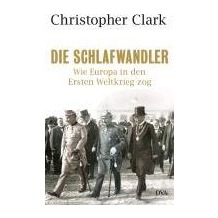 Clark, Christopher: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013
Clark, Christopher: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013
ISBN 978 3 421 04359 7, 895 Seiten, 39,95 €
Eine abgehobene Kaste führungsloser Egomanen. Christopher Clark beschreibt eindrucksvoll den Marsch der europäischen Bündnissysteme in die große Katastrophe, bei dem Frankreich eine überraschend aktive Rolle spielte.
Nach heutigen Maßstäben wäre der langjährige Leiter der britischen Außenpolitik, Sir Edward Grey, kaum eine geeignete Persönlichkeit für sein hohes Amt. Der oberste Außenpolitiker des Imperiums wußte wenig über die Welt außerhalb Großbritanniens, hatte niemals großes Interesse an Reisen gezeigt, sprach wie übrigens auch der langjährige britische Botschafter in Paris, Sir Francis Berti, keine einzige Fremdsprache und fühlte sich in Gesellschaft von Ausländern grundsätzlich unwohl.
Gleichwohl ist dem australischen Historiker Christopher Clark zuzustimmen, wenn er den passionierten Naturliebhaber Grey, der zum Leidwesen seiner Untergeben seine Fluchten aufs Land maßlos übertrieb, den einflußreichsten und zugleich rätselhaftesten Politiker der Vorkriegszeit nennt.
In seiner nun auch in deutscher Sprache vorliegenden Monographie über Vorgeschichte und Ausbruch des Ersten Weltkrieges erscheint Grey als eine archetypische Figur in einem gewaltigen Netzwerk von Diplomaten, Politikern und gekrönten Häuptern, die alle ihre eigenen, höchst ambitionierten Vorstellungen vom Gang der europäischen Politik besaßen und sie auch durchzusetzen versuchten. Es war eine abgehobene Kaste, die von sich selbst zutiefst überzeugt war und abgeschottet von der Mehrheit der Bevölkerungen die internationale Politik, trotz ihrer objektiv sichtbaren tödlichen Risiken, als einen frivolen Zeitvertreib betrieb. Diese „Schlafwandler“, wie Clark sie zum Schluß nennt, empfanden keinerlei Unbehagen, wenn sie wie etwa Edward Grey, ihren Alliierten geheime Zusagen machten, die sie im Kabinett jedoch bestritten oder falsch darstellten.
Clarks beeindruckende Tour durch die Hauptstädte der Vorkriegszeit von Belgrad bis Berlin enthüllt überall hinter den glänzenden Fassaden aus Stuck und Marmor ein polykratisches Chaos. An der Schwelle zur Moderne besaßen die europäischen Staaten zwar bereits beachtliche Regierungsapparate, aber es fehlte ihnen noch eine zentrale Autorität, wie sie früher durch die jeweiligen Monarchen verkörpert wurden. Mit Einschluß selbst der französischen Republik waren die europäischen Regierungen vor 1914 kaum mehr als Übergangssysteme zur heutigen Demokratie, ohne einen Regierungschef mit machtvoller Prärogative. Statt unter einer einheitlichen Führung handelten die einzelnen Kabinettsmitglieder nach ihrer eigenen Agenda, verschwiegen sich gegenseitig wichtige Informationen oder schlossen sogar untereinander geheime Allianzen ab. Von außen gesehen verfolgte daher keine der europäischen Großmächte in den zwei Dekaden vor der Julikrise von 1914 eine Politik, die man als konsistent oder berechenbar hätte bezeichnen können. Ambivalenz war ein prägendes Merkmal der hohen Diplomatie in der Vorkriegszeit und das außenpolitische Geschäft somit ein brandgefährliches Stochern im Nebel.
Vor allem die beiden rivalisierenden Bündnisse, hier die Triple-Entente und dort der Dreibund, spielten damals eine ganz andere Rolle als Allianzen in der heutigen multilateralen Welt. Clark kann zeigen, daß sie, anders als heute, die Lösung bilateraler Probleme, wie etwa zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich, mehrfach verhindern haben. Denn jede Macht war von der panischen Sorge erfüllt, in einer zunehmend hochgerüsteten Welt im entscheidenden Moment ohne Alliierten zu sein und vermied daher alle Schritte, welche die Kritik der verbündeten Mächte heraufbeschwören konnten.
Verdankte sich die sogenannte Triple-Entente von 1904/07 noch dem an sich hilfreichen Gedanken, daß sich koloniale Probleme eher kooperativ als konfrontativ lösen ließen, so bekam sie bald nach der ersten Marokkokrise ihre strikt antideutsche Ausrichtung. Als entscheidender Brandbeschleuniger der europäischen Katastrophe wirkte dann ab 1908 die Entwicklung auf dem Balkan, wo das Osmanische Reich schon seit der Mitte des 19. Jahrhundert einem zunehmend rasanten Erosionsprozeß unterworfen war. Noch im heimlichen Einvernehmen mit dem Zarenreich hatte sechs Jahre vor Ausbruch des Krieges Österreich-Ungarn die beiden ehemals osmanischen Provinzen Bosnien-Herzegowina, die es seit dem Berliner Kongreß von 1878 im Einverständnis mit den Großmächten okkupiert hielt, formal annektiert. Damit aber hatte die Habsburgermonarchie den Nationalismus der Serben, ihre ehemaligen Verbündeten, zum Kochen gebracht. Dessen Vertreter verbanden sich rasch mit den düpierten Russen, die für ihre Zugeständnisse in der Bosnienfrage vergebens auf internationale Zugeständnisse bei der ersehnten Kontrolle der Dardanellen gehofft hatten. Da Frankreich jedoch befürchtete, daß mit der Balkanwende der russischen Politik die Armee des Zaren im Kriegsfall sich mehr auf Österreich-Ungarn anstatt auf Deutschland konzentrieren würde – schon die einseitige Rückverlegung einer beträchtlichen Anzahl russischer Divisionen aus Kongreßpolen in das Wolgabecken hatte in Paris Schnappatmung ausgelöst – entschloß sich Staatspräsident Raymond Poincaré, das französisch-russische Bündnis gegen Deutschland von 1894 jetzt auch unter Einschluß des Balkans neu zu justieren. Nur so schien es in den Augen der Vertreter der „Grande Nation“, deren Bevölkerung im Gegensatz zu der des expandierenden Deutschen Reiches seit Jahren stagnierte, möglich, sich im Kriegsfall den vollen Einsatz seines östlichen Alliierten zu sichern.
Als schließlich das Attentat von Sarajewo am 28. Juni die europäische Öffentlichkeit schockierte, ohne sie jedoch zunächst in größere Unruhe zu versetzen, hatten die Franzosen schon längst die Lunte an das südeuropäische Pulverfaß gelegt. Poincarés spektakuläre Reise nach St. Peterburg vom 20. bis 23. Juli 1914 schildert Clark dann auch als einen jingoistischen Hexensabbat, in dem sich Russen und Franzosen gegenseitig mit ihren Beschwörungen von Bündnistreue und Kriegsbereitschaft übertrumpften und während dem der eher pazifistische französische Außenminister René Viviani, ein ehemaliger Sozialist, gleich zweimal einen Nervenzusammenbruch erlitt. Einhellig wiesen Poincaré wie auch der russische Außenminister Sergei D. Sasonow das zu diesem Zeitpunkt schon durchgesickerte habsburgische Ultimatum an Serbien zurück. Ihrer entrüstete Behauptung, daß ein souveräner Staat die Erfüllung eines derartiges Ansinnens nicht mit seiner nationalen Ehre vereinbaren könne, hält Clark mit süffisantem Vergnügen den Text des viel weiter gehenden NATO-Ultimatums von Rambouillet aus dem Jahre 1999 entgegen.
Auch wenn der Verfasser in seinen Schlußreflexionen einer eindeutigen Schuldzuweisung für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ausweicht, zeigen doch Gewichtung und Tenor seiner vorangegangenen Darstellung, daß die Mittelmächte trotz ihrer autokratischen Strukturen und ihrer Militärverliebtheit eher als Opfer denn als Täter zu betrachten sind. Daß die Reichsleitung Anfang Juli 1914 längst die Hoffnung aufgegeben hatten, noch einen Krieg gegen das rasch erstarkende Rußland vermeiden zu können, kann Ihnen angesichts einer immer aggressiver auftretenden Triple-Entente kaum noch zum Vorwurf gemacht werden. Reichskanzler Bethmann-Hollwegs Kalkül, mit der Unterstützung Österreichs in der Julikrise die russische Kriegsbereitschaft lieber sofort als später zu testen, erscheint dann auch im Kontext der damaligen Kräfteverhältnisse als folgerichtiger Schritt.
Clarks monumentales Werk, dessen Facettenreichtum hier nur angedeutet werden konnte, muß als ein Meilenstein einer neuen Sicht auf die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führenden Ereignisse gewertet werden. Schon Stefan Schmidt hatte in seiner 2010 vorgelegten Studie auf die erheblich aktivere Rolle Frankreichs auf dem Weg zur Katastrophe hingewiesen. Bei Clark mutiert der Strippenzieher Poincaré dagegen schon zur europäischen Verhängnisgestalt. Ein angedeuteter Vergleich zur aktuellen Lage in Europa mit seiner Währungskrise, den der Verfasser vielleicht auch nur dem deutschen Verlag zuliebe ins Schlußwort aufgenommen, wirkt hingegen aufgesetzt. Zwar spaltet der Euro inzwischen den Kontinent in bedenklicher Art und der Wohlstand seiner Nationen ist in echter Gefahr, doch um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, fehlen doch die gigantischen Armeen von 1914. kjb
| Blättern Sie in unserem Buchprogramm: |  |